Männer-Verdienste auch in »geschlechtstypischen« Berufen deutlich höher
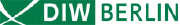 Brutto-Stundenverdienste in typischen Frauenberufen 2014 im Schnitt um acht Euro - oder 39 Prozent - niedriger als in typischen Männerberufen • Typische Männerberufe oftmals mit höherem Akademisierungsgrad – doch auch akademisierte Frauenberufe werden häufig schlechter bezahlt • Aufwertung weiblich konnotierter Berufe durch bessere Bezahlung
Brutto-Stundenverdienste in typischen Frauenberufen 2014 im Schnitt um acht Euro - oder 39 Prozent - niedriger als in typischen Männerberufen • Typische Männerberufe oftmals mit höherem Akademisierungsgrad – doch auch akademisierte Frauenberufe werden häufig schlechter bezahlt • Aufwertung weiblich konnotierter Berufe durch bessere BezahlungBerufe, in denen überwiegend Frauen arbeiten, sind im Jahr 2014 um rund acht Euro brutto in der Stunde geringer entlohnt worden als männlich dominierte Berufe. In typischen Frauenberufen wurden durchschnittlich zwölf Euro pro Stunde verdient, in typischen Männerberufen 20 Euro. Die Differenz beträgt damit fast 40 Prozent.
Dies zeigt eine Sonderauswertung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) auf Basis von Daten der Langzeitstudie Sozio-oekonomisches Panel (SOEP) anlässlich des Equal Pay Day am 19. März 2016. Die Analyse berücksichtigt Erwerbstätige in der Privatwirtschaft in typischen Frauen- und Männerberufen. Hierbei handelt es sich um Berufe, in denen die Anteile von Frauen beziehungsweise Männern jeweils bei 70 Prozent und mehr liegen. Der Unterschied zwischen den Brutto-Stundenlöhnen in typischen Frauen- und Männerberufen bewegt sich seit 2001 auf hohem Niveau und hat sich im Untersuchungszeitraum nur leicht verringert.
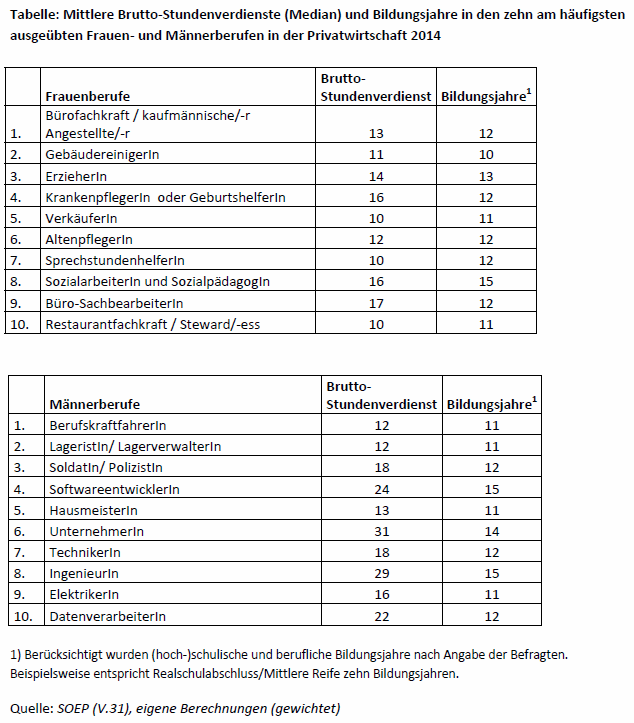
Akademisierungsgrad beinflusst die Verdienstlücke – aber nicht nur
Eine ökonomische Erklärung für die bessere Bezahlung in Männerberufen ist der höhere Anteil akademischer Abschlüsse in dieser Gruppe. Ein Vergleich der zehn am häufigsten ausgeübten Frauen- und Männerberufe auf Basis des SOEP zeigt, dass drei der häufigsten Männerberufe – nämlich SoftwareentwicklerIn, UnternehmerIn und IngenieurIn – eine langjährige Qualifikation erfordern, während dies bei den häufigsten Frauenberufen nur für die SozialpädagogInnen zutrifft. »Eine weitere Akademisierung der Frauenberufe vor allem im Bereich Gesundheit und Pflege wäre daher ein Schritt in die richtige Richtung zu mehr Entgeltgleichheit zwischen Frauen und Männern«, argumentiert die DIW-Forschungsdirektorin für Gender Studies Elke Holst.
Dies dürfte jedoch als Erklärung für die Verdienstlücke noch nicht ausreichen. Ein weiterer Faktor bei der Entgeltungleichheit ist neben dem niedrigen Akademisierungsgrad die Tatsache, dass selbst akademisierte Frauenberufe deutlich schlechter bezahlt werden als Männerberufe. Beispielsweise erhielten SozialarbeiterInnen 2014 für eine Stunde Erwerbsarbeit im Schnitt 16 Euro brutto, wohingegen der männlich dominierte Beruf der IngenieurInnen mit durchschnittlich 29 Euro vergütet wurde. Da die Bildungsdauer in beiden Berufen mit 15 Jahren gleich lang ist, kann man daraus schließen, dass Erwerbstätige in diesen Männerberufen finanziell stärker von ihrer Investition in Bildung profitieren.
Männlich konnotierte Tätigkeiten erfahren höhere Wertschätzung
Eine häufig in der Sozialwissenschaft angeführte Erklärung ist, dass männlich konnotierte Tätigkeiten gesellschaftlich eine höhere Wertschätzung erfahren als weiblich konnotierte. Holst verweist auf Studien, die dies belegen: »Da typische Frauenberufe meist im Bereich Pflege, Erziehung und Soziales angesiedelt sind, wird auch von der gesellschaftlichen Abwertung der Care-Arbeit gesprochen«. In der Tat verdienten AltenpflegerInnen im Jahr 2014 durchschnittlich zwölf Euro brutto pro Stunde. Demgegenüber wurde der von Männern dominierte Beruf der TechnikerInnen mit 18 Euro pro Stunde vergütet, obwohl Erwerbstätige in beiden Berufen im Durchschnitt gleichermaßen zwölf Jahre in ihre Bildung investiert hatten. »Dieses Muster dürfte auf die Vorstellung zurückgehen, dass Care-Arbeit keine spezifische Qualifikation erfordert, da sie in der Vergangenheit vor allem in den Bereichen Kinderbetreuung und Altenpflege unbezahlt von Frauen in Familien geleistet wurde«, so Gender-Expertin Holst. Durch die stark gestiegene Erwerbsbeteiligung der Frauen wächst jedoch die Nachfrage nach institutionellen Angeboten für Kinderbetreuung und Altenpflege. Dadurch wird Care-Arbeit zunehmend marktmäßig organisiert – jedoch vergleichsweise gering entlohnt.
Die geringere monetäre Bewertung von typischen Frauenberufen trägt maßgeblich zur Verdienstlücke zwischen Frauen und Männer (Gender Pay Gap) bei. »Um diese zu schließen, bedarf es auch einer Aufwertung der Care-Arbeit durch höheren Löhne in typischen Frauenberufen«, so Holst.
Ähnliche Themen in dieser Kategorie
Unbereinigte Lohnlücke bleibt konstant: Frauen verdienen 16 Prozent weniger als Männer Der durchschnittliche Bruttostundenverdienst von Frauen in Deutschland lag im Jahr 2025 um 16 Prozent unter dem von Männern. Dies teilt das Statistische Bundesamt (Destatis) mit. …
IAB-Studie: Frauen fehlt Einblick in Gehaltsstrukturen Frauen wissen seltener als Männer, was ihre Kolleginnen verdienen. Das zeigt eine aktuelle Auswertung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Damit verstetigt sich ein Muster, das für die Gleichstellung …
Die Erwerbstätigkeit von Frauen ist seit dem Jahr nach der deutschen Vereinigung 1991 bundesweit um 30 Prozent gestiegen, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt. Waren 1991 mehr als die Hälfte (57 Prozent) der Frauen erwerbstätig, lag die Erwerbstätigenquote von …
Rückgang der Verdienstungleichheit zwischen Frauen und Männern in Deutschland Die Kluft zwischen den Geschlechtern auf dem deutschen Arbeitsmarkt verringert sich langsam, aber stetig. Der Gender Gap Arbeitsmarkt, ein umfassender Indikator für Verdienstungleichheit, ist im Jahr …

