KMK-Prognose zeigt Schülerboom – und ein Ende erst nach 2032
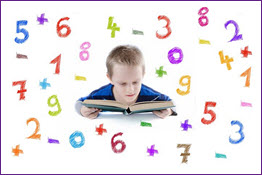
Schülerzahlen erreichen bis 2032 Rekordhöhe
Die Zahl der Schülerinnen und Schüler in Deutschland wächst weiter. Nach den neuen Vorausberechnungen der Kultusministerkonferenz (KMK) wird der Höchststand mit knapp 11,8 Millionen im Jahr 2032 erreicht – rund 600.000 mehr als 2024. Selbst danach bleibt das Niveau bis 2040 deutlich über dem heutigen Wert.
Die Prognose dient den Ländern als Grundlage für die Schul- und Personalplanung sowie für Investitionen in Gebäude und digitale Ausstattung.
Rund 24.000 Klassen mehr
Das Wachstum entspricht der gesamten Schülerzahl eines Bundeslandes wie Rheinland-Pfalz. Umgerechnet bedeutet das bundesweit rund 24.000 zusätzliche Klassen oder fast 1.200 neue Schulen. Erst nach 2032 beginnt der allmähliche Rückgang.
Doch auch 2040 werden laut KMK mit 11,3 Millionen Kindern und Jugendlichen noch 77.000 mehr die Schulen besuchen als heute – ein Plus, das etwa der Schülerzahl Bremens entspricht.
Bildungsministerin Oldenburg mahnt vorausschauendes Handeln an
KMK-Präsidentin Simone Oldenburg betonte, jedes Kind habe Anspruch auf gute Bildung und hochwertige Abschlüsse. Das Bildungssystem müsse so gestaltet werden, dass es steigende Zahlen ebenso bewältige wie regionale und strukturelle Unterschiede. Dafür brauche es frühzeitige Planung, mehr Lehrkräfte und eine moderne Infrastruktur. Bildung sei, so Oldenburg, Grundlage für gesellschaftlichen Zusammenhalt und wirtschaftliche Zukunft.
Große Unterschiede zwischen Ost und West
Während in den westdeutschen Flächenländern die Schülerzahl bis 2033 um fast acht Prozent zunimmt und bis 2040 noch immer vier Prozent über dem Ausgangswert liegt, beginnt der Rückgang in den ostdeutschen Ländern schon 2027. Hier rechnen die Prognosen bis 2040 mit einem Minus von mehr als 16 Prozent. Auch in den Stadtstaaten sinkt die Zahl der Schülerinnen und Schüler – um rund fünf Prozent gegenüber 2024.
Verschobene Effekte zwischen den Schulstufen
Die Entwicklung wirkt sich je nach Schulstufe unterschiedlich aus. In der Primarstufe wird die Zahl der Kinder bis 2040 um etwa neun Prozent sinken. In der Sekundarstufe I erreicht sie 2031 ihren Höchstwert mit knapp fünf Millionen und liegt 2040 noch leicht über dem Niveau von 2024. Besonders stark wächst die Sekundarstufe II: Bis 2040 wird hier ein Plus von fast zehn Prozent erwartet.
Ende des Wachstums in Sicht
Die demografische Welle läuft allmählich aus. Die geburtenschwächeren Jahrgänge, die nun ins Bildungssystem eintreten, werden es in den kommenden Jahrzehnten durchlaufen und langfristig zu einem Rückgang führen – voraussichtlich über 2040 hinaus. Damit endet die Phase steigender Schülerzahlen, auch wenn das Gesamtniveau bis dahin hoch bleibt.
Hintergrund
Die aktuelle Entwicklung wird von zwei gegenläufigen demografischen Trends bestimmt: Zum einen wirkt sich die hohe Zuwanderung der vergangenen Jahre – insbesondere infolge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine – deutlich aus. Rund 230.000 Schülerinnen und Schüler ukrainischer Herkunft sind in der Prognose berücksichtigt.
Zum anderen ist die Geburtenrate seit 2022 spürbar gesunken. Laut Statistischem Bundesamt lag sie 2024 bei 1,35 Kindern pro Frau – und damit rund neun Prozent niedriger als noch 2022. Diese geburtenschwachen Jahrgänge werden in den kommenden Jahrzehnten das Bildungssystem prägen und langfristig zu einem Rückgang der Schülerzahlen führen.
Die Kultusministerkonferenz veröffentlicht seit 1963 regelmäßig Vorausberechnungen zur Entwicklung der Schülerzahlen. Die aktuelle Prognose basiert auf den Ist-Zahlen des Schuljahres 2023/24 sowie den jeweils aktuellen Bevölkerungsprognosen der Länder. Sie folgt dem Prinzip einer struktur- und bestandsorientierten Trendprognose: Das derzeitige Übergangs- und Wahlverhalten der Schülerinnen und Schüler wird fortgeschrieben und bei der Modellanlage und Quotenfestsetzung werden die schon erkennbaren Entwicklungen mitberücksichtigt. Die Ergebnisse zeigen somit, wie sich die Zahlen bei gleichbleibenden Rahmenbedingungen und voraussehbaren Trends entwickeln würden.
Die Vorausberechnung ist ein zentrales Planungsinstrument der Länder. Sie dient nicht nur der Abschätzung des Lehrkräftebedarfs, sondern auch der Planung von Schulbau, Ausstattung und Programmen zur individuellen Förderung. Zudem bildet sie die Grundlage für die Berechnung des künftigen Bedarfs an Ausbildungsplätzen und für die Hochschulprognosen.
VERWEISE
- KMK: Vorausberechnung der Zahl der Schüler*innen und Absolvierenden bis 2040 ...
- siehe auch: »Herausforderung der Schulpolitik: Mehr Schüler, aber auch mehr ohne Abschluss« ...
- vgl. Destatis: »Zahl der Schulanfängerinnen und -anfänger 2025 um 2,2 % gesunken« ...
Ähnliche Themen in dieser Kategorie
Bund und Länder verabschieden Digitalpakt 2.0 Die flächendeckende Digitalisierung der deutschen Schullandschaft erhält eine langfristige finanzielle Absicherung. Am 18. Dezember 2025 einigten sich die Bildungsministerien der Länder und das Bundesministerium für Bildung, …
Rund 198 Milliarden Euro für Bildung aus öffentlicher Hand Die Bildungsausgaben von Bund, Ländern und Gemeinden sind im Jahr 2024 auf rund 198 Milliarden Euro gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, waren das nominal (nicht …
Mehr Chancen durch Ganztagsangebote Der Ausbau von Ganztagsschulen in der Grundschule erhöht laut einer neuen ifo-Studie die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder nach der vierten Klasse ein Gymnasium besuchen. Die Forschenden stellten zudem fest, dass Ganztagsbetreuung positive …
Überflüssige Kopfnoten kosten über 200 Millionen Euro Die Vergabe von Verhaltensnoten – sogenannte »Kopfnoten« – ist in deutschen Schulen weit verbreitet, hat aber laut aktueller Forschung keinen nachweisbaren Einfluss auf den Bildungserfolg oder den späteren Berufseinstieg …

