Nahles fordert Flexibilität für alle - und ein Recht auf Weiterbildung
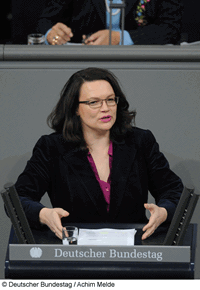
Die fortschreitende Digitalisierung, die vor allem unter dem Begriff »Industrie 4.0« diskutiert wird, führt zwangsläufig auch zu einer veränderten Arbeitswelt
Wie diese genau aussehen und welche neuen Anforderungen sie mit sich bringen wird, ist abschließend noch nicht zu beurteilen. Fest steht allerdings, dass vielfach neue Arbeitsformen entstehen und neue Kompetenzen benötigt werden.
Andrea Nahles, Ministerin für Arbeit und Soziales, hat hierzu einen Dialog über die »Arbeit 4.0« mit Unternehmen, Gewerkschaften, Verbänden und der Wissenschaft angestoßen, dessen Ziel es ist, den erforderlichen Handlungsbedarf und Empfehlungen für die Entwicklung begleitender Rahmenbedingungen herauszuarbeiten.
Mit neuen Technologien, der weiteren Automatisierung und Vernetzung von Produktionsstätten, neuen Geschäftsmodelle und Arbeitsformen wie Crowdworking sowie dem zunehmenden Einsatz von Big Data und künstlicher Intelligenz in Dienstleistungsbranchen können leicht auch Ängste entstehen, dass menschliche Arbeit verdrängt und Jobs verloren gehen.
Nahles befasst sich mit diesen Fragen ausführlich in einem Artikel des Berliner Tagesspiegels und kommt dabei zu der »bisherigen Erkenntnis«: »Menschliche Arbeit wird weiterhin im Mittelpunkt der Wirtschaft stehen«, wobei die konkreten Tätigkeiten und die gefragten Qualifikationen jedoch andere sein werden.
Es ist davon auszugehen, dass diese veränderten Anforderungen sich schneller und dynamischer entwickeln werden als dies in der Vergangenheit der Fall war. Das bedeutet für Beschäftigte (wie auch für Arbeitsuchende), dass sie die Möglichkeit einer fortwährenden Kompetenzanpassung geboten bekommen müssen. Dies unter Berücksichtigung der betrieblichen Erfordernisse und unter Einbeziehung der persönlichen Voraussetzungen.
Dabei handelt es sich um einen dynamischen Prozess, der eine hohe Flexibilität erfordert. Dies umzusetzen sei, so Nahles, »nur möglich, wenn wir die Institutionen des Sozialstaats, allen voran bei der Bildung, darauf vorbereiten und gleichzeitig mehr Spielräume auf betrieblicher und tariflicher Ebene ermöglichen«. Für diese neue digitale Arbeitswelt liegen kaum Erfahrungswerte vor; sie müssten vielleicht auch experimentell erarbeitet werden.
Eine mögliche Richtung, in die die »Arbeit 4.0« gehen könnte, hat Nahles auch bereits ins Auge gefasst: Perspektivisch könne es ein Recht auf Weiterbildung unter Einschluss einer regelmäßigen Berufs- und Weiterbildungsberatung geben. Damit würde sicherzustellen sein, dass Beschäftigte ihr Wissen und ihre Fähigkeiten erhalten, bei Bedarf ausbauen oder auch in neue Bereiche umschulen.
Ähnliche Themen in dieser Kategorie
Orientierung in Zeiten raschen Wandels Der TÜV-Verband legt mit dem Leitfaden »Weiterbildung in Zeiten der Transformation« eine praxisnahe Handreichung vor, die Unternehmen beim Aufbau einer strategischen Weiterbildungsplanung unterstützt. Im Zentrum stehen …
KI-Fortbildungsinitiative gestartet Das Ministerium für Schule und Bildung des Landes Nordrhein‑Westfalen (MSB NRW) hat die landesweite Fortbildungsinitiative »KI‑Skilling.NRW« für Lehrkräfte gestartet. Ziel ist, rund 200.000 Lehrpersonen im Bundesland darin zu stärken, …
Weiterbildungsangebote und frühzeitige Förderung als Motor des digitalen Wandels Die digitale Kompetenz der deutschen Bevölkerung bleibt im europäischen Vergleich hinter der Spitze zurück. Friederike Hertweck vom RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung sieht einen …
Fachkräftemangel treibt digitale Qualifizierung in Unternehmen voran Drei Viertel der deutschen Unternehmen investieren aktuell in die digitale Weiterbildung ihrer Beschäftigten. Das zeigt eine repräsentative Umfrage des Digitalverbands Bitkom unter 603 Unternehmen mit …

