Bundesverwaltungsgericht fragt nach Verfassungsmäßigkeit des BaFöG-Bedarfssatzes
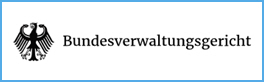
Die Regelung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes (BAföG), nach der im Zeitraum von Oktober 2014 bis Februar 2015 ein monatlicher Bedarf für Studierende in Höhe von 373 Euro galt (§ 13 Abs. 1 Nr. 2 BAföG), verstößt nach Überzeugung des Bundesverwaltungsgerichts gegen den aus dem verfassungsrechtlichen Teilhaberecht auf chancengleichen Zugang zu staatlichen Ausbildungsangeboten folgenden Anspruch auf Gewährleistung des ausbildungsbezogenen Existenzminimums (Art. 12 Abs. 1, Art. 3 Abs. 1 Grundgesetz - GG - in Verbindung mit dem Sozialstaatsprinzip des Art. 20 Abs. 1 GG).
Das Bundesverwaltungsgericht hat deshalb beschlossen, dem Bundesverfassungsgericht die Frage der Vereinbarkeit des Bedarfssatzes mit den genannten Bestimmungen des Grundgesetzes zur Entscheidung vorzulegen.
Der Fall
Die Klägerin studierte im Wintersemester 2014/2015 an einer staatlichen Hochschule in Deutschland. Sie erhielt für den Zeitraum Oktober 2014 bis Februar 2015 unter Anrechnung elterlichen Einkommens Ausbildungsförderung nach Maßgabe der Bestimmungen des BAföG. Die entsprechenden Förderungsbescheide griff die Klägerin mit der Begründung an, der für den fraglichen Zeitraum geltende Bedarfssatz für Studierende sei in verfassungswidriger Weise zu niedrig bemessen. Ihre auf höhere BAföG-Leistungen gerichtete Klage blieb vor den Verwaltungsgerichten in erster und zweiter Instanz erfolglos.
Die Entscheidung
Nach Überzeugung des Bundesverwaltungsgerichts ist die Festlegung des Bedarfssatzes im Zeitraum von Oktober 2014 bis Februar 2015 mit dem verfassungsrechtlichen Teilhaberecht auf gleichberechtigten Zugang zu staatlichen Ausbildungsangeboten (Art. 12 Abs. 1, Art. 3 Abs. 1 GG i.V.m. Art. 20 Abs. 1 GG) nicht vereinbar. Dieses Teilhaberecht verpflichtet den Gesetzgeber, für die Wahrung gleicher Bildungschancen Sorge zu tragen und im Rahmen der staatlich geschaffenen Ausbildungskapazitäten allen entsprechend Qualifizierten eine (Hochschul-) Ausbildung in einer Weise zu ermöglichen, die den Zugang zur Ausbildung nicht von den Besitzverhältnissen der Eltern abhängig macht, sondern ihn so gestaltet, dass soziale Gegensätze hinreichend ausgeglichen werden und soziale Durchlässigkeit gewährleistet wird.
Obgleich dem Gesetzgeber dabei ein weiter Gestaltungsspielraum zusteht, ist eine den Mindestanforderungen gerecht werdende Förderung verfassungsrechtlich geboten, die verhindert, dass das tatsächliche Gebrauchmachen von dem verfassungsrechtlichen Teilhaberecht nicht an einer unzureichenden finanziellen Ausstattung von Ausbildungswilligen scheitert. Weil dies voraussetzt, dass die materiellen Anforderungen für die Durchführung der Ausbildung gesichert sind, folgt aus dem Teilhaberecht ein Anspruch auf staatliche Förderung für diejenigen, die ihr ausbildungsbezogenes Existenzminimum nicht aus eigenen oder von Seiten Dritter (Eltern etc.) zur Verfügung gestellten Mitteln bestreiten können und deren Zugang zur Ausbildung, obgleich sie die subjektiven Zugangsvoraussetzungen erfüllen, ohne eine entsprechende staatliche Unterstützung aus tatsächlichen Gründen vereitelt oder unzumutbar erschwert würde. Dem ist der Gesetzgeber mit der Zielsetzung, Chancengleichheit zu ermöglichen, zwar in der Weise nachgekommen, dass er einen Rechtsanspruch auf Ausbildungsförderung für eine der Neigung, Eignung und Leistung entsprechende Ausbildung nach Maßgabe des Gesetzes einräumt, der den Lebensunterhalt und den Ausbildungsbedarf des Studierenden decken soll (§ 1, § 11 Abs. 1 BAföG).
Allerdings ist er nach Überzeugung des Bundesverwaltungsgerichts mit der konkreten Festlegung des hier im Streit stehenden Bedarfssatzes hinter den verfassungsrechtlichen Anforderungen an die Gewährleistung eines ausbildungsbezogenen Existenzminimums für den von ihm als förderungswürdig und -bedürftig ausgewiesenen Personenkreis zurückgeblieben. Die Ermittlung des Bedarfssatzes unterliegt der Prüfung, ob der Gesetzgeber im Rahmen seines Gestaltungsspielraums ein zur Bemessung taugliches Berechnungsverfahren gewählt hat, ob er die erforderlichen Tatsachen im Wesentlichen vollständig und zutreffend ermittelt und schließlich, ob er sich in allen Berechnungsschritten mit einem nachvollziehbaren Zahlenwerk innerhalb dieses gewählten Verfahrens und dessen Strukturprinzipien im Rahmen des Vertretbaren bewegt hat. Dieser Prüfung hält der streitige Bedarfssatz nicht stand. Eine den vorgenannten Anforderungen gerecht werdende Festsetzung kann unter anderem deshalb nicht nachvollzogen werden, weil das gewählte Berechnungsverfahren im Unklaren lässt, zu welchen Anteilen der Pauschalbetrag auf den Lebensunterhalt einerseits und die Ausbildungskosten andererseits entfällt und diese abdecken soll. Zudem fehlt es an der im Hinblick auf die Lebenshaltungs- und Ausbildungskosten gebotenen zeitnahen Ermittlung des entsprechenden studentischen Bedarfs. Hier lag der Festsetzung aus dem Jahre 2010, die bis 2016 galt, eine Erhebung aus dem Jahr 2006 zugrunde.
Weil das Bundesverwaltungsgericht als Fachgericht nicht befugt ist, die Verfassungswidrigkeit eines Parlamentsgesetzes selbst festzustellen, hat es das Revisionsverfahren ausgesetzt und die Frage dem Bundesverfassungsgericht zur Entscheidung vorgelegt.
BVerwG 5 C 11.18 - Beschluss vom 20. Mai 2021
Vorinstanzen:
OVG Lüneburg, 4 LC 392/16 - Beschluss vom 27. November 2018 -
VG Osnabrück, 4 A 87/15 - Beschluss vom 17. November 2016 -
VERWEISE
Ähnliche Themen in dieser Kategorie
Krise der staatlichen Studienunterstützung: Nur jede siebte Person nutzt öffentliche Fördermittel Staatliche Instrumente zur Studienfinanzierung verlieren in Deutschland massiv an Bedeutung. Wie die eine CHE-Auswertung (»CHECK Studienfinanzierung 2026«) belegt, nehmen derzeit …
Rückgang der BAföG-Förderung trotz struktureller Reformen Die Anzahl der durch das Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) unterstützten Studierenden in Deutschland ist zwischen 2022 und 2024 leicht gesunken. Wie aus dem aktuellen 24. BAföG-Bericht der Bundesregierung …
Die Hälfte der Studierenden mit eigener Haushaltsführung verfügt über weniger als 930 Euro im Monat, 50 Prozent der Auszubildenden über weniger als 1.278 Euro Studierende und Auszubildende in Deutschland sind einer deutlichen finanziellen Belastung durch hohe Wohnkosten …
Im Jahr 2024 erhielten 612.800 Personen Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG). In 2024 ist die Zahl der Personen, die Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz (»BAföG«) erhielten, auf ein Rekordtief seit 2000 gesunken. Laut Angaben des …

